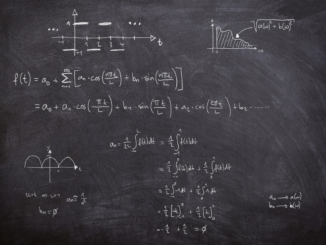Das EPI-Institut, also das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, hat Richtlinien zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) durch Europäische Patentanwälte erlassen. Diese könnten auch für Mandanten interessant sein.
Den vorliegenden Blogbeitrag können Sie sich auch in unserem
Podcast Patent, Marke & Co. anhören.
Derzeit mischt der Boom der Künstlichen Intelligenz sämtliche Branchen auf. Auch der Bereich der Rechtsberatung durch Patentanwälte ist hiervon betroffen. Egal, ob man mit dem den Klassiker ChatGPT oder einem lokalen KI-Modell herumprobiert hat: Man muss neidlos anerkennen, dass die von der KI gelieferten Ergebnisse bereits jetzt – abgesehen von einigen Schwächen – beeindruckend sind. Geht man überdies davon aus, dass diese Modelle erst am Beginn ihrer Entwicklung stehen, so kann einem bei aller Faszination Angst und Bange werden, was das Überleben des Berufsstandes anbelangt. Aber es weiß wohl niemand besser als der Patentanwalt, dass überlegene technische Entwicklungen nicht aufzuhalten sind. Man sollte sich daher auch zeitnah damit befassen. Wie heißt es so schön: Entweder Du gehst mit der Zeit oder Du gehst mit der Zeit.
Richtlinien für Europäische Patentanwälte
Und was ist fast unvermeidlich, wenn in Europa eine neue Technologie Einzug hält? Richtig. Diese muss erst einmal akribisch reglementiert werden. Für Europäische Patentanwälte hat das nunmehr das EPI-Institut übernommen. Das EPI ist das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, mithin eine Art Kammer für European Patent Attorneys, vergleichbar mit der Patentanwaltskammer für Deutsche Patentanwälte. So wurden von dem genannten Institut Richtlinien zur Verwendung von generativer KI in der Arbeit von Europäischen Patentanwälten erlassen.
Beim Blick in die im November 2024 verabschiedeten Richtlinien fällt auf, dass es sich im Kern um Selbstverständlichkeiten für einen Patentanwalt handelt, wobei eine der Regelungen eher amüsant, eine andere hingegen übergriffig erscheint. Da die Richtlinien auch interessante Aspekte für Mandanten beinhalten, soll hier ein kurzer Blick darauf geworfen werden.
Vertraulichkeit sicherstellen
Wesentliche Punkte (2a, 2b, 6) der Richtlinien zur Nutzung von KI betreffen die Sicherstellung der Vertraulichkeit. So müssen Patentanwälte die Vertraulichkeit von Trainingsdatensätzen, Eingabeaufforderungen und anderen Inhalten gewährleisten, die an das KI-Modell übermittelt werden. Dies schließt insbesondere das Wissen über mögliche Offenlegungen ein, die durch die Nutzung der jeweiligen KI entstehen können. Im Zweifel soll auf die Nutzung einer KI verzichtet werden, bei der eine Geheimhaltung nicht gewährleistet ist.
Einer solchen Richtlinie hätte es kaum bedurft, zumal Patentanwälte gebetsmühlenartig davor warnen, eine Erfindung vor der Anmeldung zum Patent der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn wird eine Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so wird diese zum Stand der Technik, der wiederum eine Patenterteilung vereiteln kann. Dies schließt nach meinem Verständnis auch die Übermittlung eines Erfindungsgedankens an beispielsweise ChatGPT aus. So sichert ChatGPT zwar Vertraulichkeit von Daten zu, gibt aber letztlich auch die Empfehlung, „keine sensiblen oder personenbezogenen Daten einzugeben, wenn die absolute Vertraulichkeit der übermittelten Informationen sichergestellt sein soll“. Auch Erfinder sollten dies beherzigen und sich mit einer solchen KI allenfalls über den Stand der Technik, nicht aber über die Erfindung unterhalten.
Patentanwälte sollen Mandantenwunsch berücksichtigen
Ein wichtiger Punkt (4) betrifft die Berücksichtigung des Mandantenwunsches bzw. die Einstellung des Mandanten zur Nutzung von KI durch seinen Vertreter. So müssen Europäische Patentanwälte vor der Nutzung generativer KI stets die Wünsche des Mandanten in Bezug auf die Verwendung von KI-Tools ermitteln. Sollten Sie als Mandant also mit der Frage konfrontiert sein, ob Sie den Einsatz eines entsprechenden Werkzeuges gestatten, so dürfen Sie dies durchaus verneinen.
Mein Haus, mein Auto, meine KI
Eine der Richtlinien (5a) hat mich zum Schmunzeln gebracht. Diese besagt, dass Europäische Patentanwälte durchaus auf Webseiten und in ähnlichen Veröffentlichungen angeben dürfen, dass unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Die Richtlinie schränkt jedoch dahingehend ein, dass eine solche Bekanntgabe genau, fair und würdevoll sein und keine Diskriminierung zwischen Patentanwälten fördern soll.
Vor meinem geistigen Auge entstand unweigerlich eine Szene, in der sich zwei Patentanwälte an einem Tisch zusammenfinden. Beide tauschen gespielte Freundlichkeiten aus. Dann knallt einer von beiden sukzessive Fotos auf den Tisch: „Mein Haus. Mein Auto, Meine KI!“. Ganz im Sinne der Sparkassenwerbung aus den 90er Jahren.
Faire Gebühren?
Der letzte Punkt (8) der Richtlinien betrifft die Festlegung von Gebühren für Arbeitsergebnisse, die unter Verwendung Künstlicher Intelligenz erzielt wurden. Nach meinem Verständnis also auch in Rechnung gestellte Honorare. Dabei sollen Europäische Patentanwälte „höchstens Gebühren verlangen, die den aufgewendeten Zeit- und Arbeitsaufwand, den Schwierigkeitsgrad und/oder das Risiko angemessen widerspiegeln“. Darüber hinaus sollen Patentanwälte Gebühren erheben können, die „die Schwierigkeit oder den Umfang der Aufgabe bei der Einrichtung oder Schulung von KI-Tools, Abonnementgebühren für KI-Tools und die Überprüfung KI-generierter Arbeit fair widerspiegeln“.
Dieser Punkt ist insofern irritierend, als dass es aus gutem Grunde keine Gebührenordnung für Deutsche und Europäische Patentanwälte gibt. Dies im Gegensatz zu Rechtsanwälten, deren Gebühren durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für bestimmte Dienstleistungen festgelegt sind, worüber viele Rechtsanwaltskollegen nicht sonderlich glücklich sind. Vor allen Dingen stellt sich doch die Frage, was eine „faire“ Gebühr sein soll und wer dies festlegt.
Nach meinem Verständnis gibt es nur einen Mechanismus, der eine „faire“ Gebühr zu ermitteln vermag, nämlich der Markt. Und diesem ist es egal, ob das Arbeitsergebnis mit oder ohne Künstliche Intelligenz erzielt wurde. In eigener Sache sei abschließend noch der Hinweis gestattet, dass es bei mir noch keine Beschwerden bezüglich eines „unfairen“ Honorars gab …